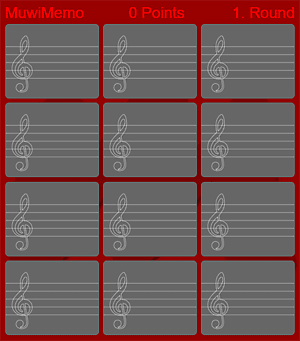Instrumentalmusik (1929)
Instrumentalmusik ist im Gegensatz zur Vokalmusik die durch Instrumente ausgeführte Musik. Da man die von Instrumenten begleitete Vokalmusik zur Vokalmusik zu rechnen pflegt, so hat das Wort Instrumentalmusik die vulgäre Bedeutung einer Musik erhalten, welche nur von Instrumenten ausgeführt wird, bei der also Gesang völlig ausgeschlossen ist.
Historisch geht aber natürlich die Entwicklung der begleitenden Instrumentalmusik Hand in Hand mit derjenigen der Instrumentalmusik überhaupt, nicht aber mit der der Vokalmusik, da sie von der Entwicklung der Instrumente abhängig ist. Ob die reine oder die begleitende Instrumentalmusik älter ist, lässt sich nicht entscheiden. Doch ist anzunehmen, dass für Blasinstrumente der Gebrauch ohne Gesang, dagegen für Saiteninstrumente der begleitende Gebrauch der frühere war, da wohl derselbe Mensch singen und ein Saiteninstrument spielen, nicht aber singen und blasen kann. Das gemeinsame Musizieren mehrerer Menschen ist aber (sobald es sich um mehr als das Markieren eines Rhythmus handelt) schon ein Stadium höherer Entwicklung. Bei den Griechen finden wir das Solo-Aulosspiel (Aulesis) bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. so weit entwickelt, dass Sakadas aus Argos um 586 für dasselbe Gleichberechtigung mit den anderen Künsten bei den pythischen Spielen erlangte. Auch das selbständige Kitharaspiel (Kitharisis) soll nicht lange darauf durch Agelaos von Tegea (um 554) zu Ehren gebracht worden sein. Aus Plutarchs Mitteilungen über die ältere Musik der Griechen geht hervor, dass die Aulosmusik sich früh in rhythmisch sehr buntgestaltigen Weisen ergangen hat, dagegen die ältere Kitharamusik sehr einfach war. Man wird kaum fehlgehen mit der Annahme, dass die (durchaus solistische) Auletik und Kitharistik in der Hauptsache freie Improvisation gewesen ist, wie auch für die Instrumentalmusik des Mittelalters schriftliche Aufzeichnung anscheinend im Allgemeinen verschmäht wurde. Diese Vermutung wird durch den Umstand bestätigt, dass uns aus dem Altertum und frühen Mittelalter Denkmäler der Instrumentalmusik nicht erhalten sind.
Die begleitende Instrumentalmusik der Alten war nichts anderes als ein Mitspielen der Gesangsmelodien im Einklang (oder der Oktave) mit gelegentlichen Verzierungen und Zwischenspielen (Κροῦσις ὑπὸ τὴν ῳδήν). Die Blechblasinstrumente wurden bis tief ins Mittelalter nicht für eigentliche Kunstmusik, sondern nur als militärische Signalinstrumente sowie bei Aufzügen und Opfern, wo Massenwirkung bezweckt war, angewendet (Salpinx, Tuba, Lituus, Buccina). Erst in den mittelalterlichen Festspielen bei fürstlichen Vermählungen sowie in den Mysterien (geistlichen Schauspielen) bildeten sich wohl die Anfänge mehrstimmiger instrumentaler Kunstmusik aus. Doch ist schon in einer Chanson von Petrus Fontaine (ca. 1400) der Kontratenor ausdrücklich für trompette [sic] bestimmt.
Eine neue Phase der Entwicklung der Instrumentalmusik beginnt mit dem Auftreten der Streichinstrumente. Die ältesten Spuren geigenartiger Instrumente im Abendland reichen bis ins 9. Jahrhundert n. Chr., wo nicht weiter (vgl. Streichinstrumente). Als Begleitinstrument der Troubadoure wie als Lieblings-Soloinstrument fahrender Spielleute, mit dem sie, wohin sie kamen, zum Tanz aufspielten, entwickelte sich die Fiedel (Fidula (bei Otfrid), Viola, Viella; Giga, Gigue, Geige). Sie machte allerlei Wandlungen durch, so dass wir schon im 14. Jahrhundert eine größere Anzahl verschieden gebauter Streichinstrumente antreffen. Die kithara-ähnlichen Saiteninstrumente (Rotta, Harfe) traten wegen ihres schnell verhallenden Klanges allmählich gegen die Streichinstrumente zurück, erlangten aber seit dem 14. Jahrhundert in den von Spanien aus sich über Europa verbreitenden Lauten wieder höhere Bedeutung. Neben der Fiedel erfreute sich als Dilettanteninstrument mindestens seit dem 10. Jahrhundert die Drehleier (vgl. Vielle) allgemeiner Verbreitung. Sie hat schon damals die unausgesetzt mittönenden Bordune, welche auch der mindestens ebenso alten Sackpfeife (vgl. Musette, siehe auch Launeddas) eignen.
Einen besonderen Aufschwung nimmt die Instrumentalmusik im 14. Jahrhundert. In Frankreich entsteht in dieser Zeit die wohl aus der Begleitpraxis der Troubadours und Jongleurs herausgewachsene, mit kunstvollem Instrumentalspiel versehene Monodie, die in der zweiten· Hälfte des 14. Jahrhunderts auch auf Italien übergreift und sich dann im 15. Jahrhundert behauptet, während zugleich in der Kirchenmusik der imitierende A-cappella-Stil sich ausbildet. Aus zeitgenössischen Aussagen und bildlichen Darstellungen geht hervor, dass die Begleitung vorzugsweise Streichinstrumenten und Lauteninstrumenten übertragen wurde. Doch spielen früh auch Klavierinstrumente (Klaviere, kleine Orgeln) eine Rolle. Einen Begriff von einer vollstimmigen Festmusik mit Singstimmen und Instrumenten aller Art in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gibt die Symphonia in Cod. 1494 der Leipziger Univ.-Bibl. (Riemann, Hdb. d. MG. II. 1, S. 207ff) durch die in dem untergelegten doppelten (weltlichen und geistlichen) Texte genannten Instrumente.
Etwa seit 1500 kam dann der Gebrauch auf, mehrstimmige (A-cappella-) Gesangsstücke auch nur mit Instrumenten einer Gattung (einem "Chor", "Akkord", einem "Stimmwerk") auszuführen. Scheinbar wird daher die Literatur der Instrumentalmusik um diese Zeit besonders arm (nur Lauten- und Orgelarrangements werden in Menge gedruckt), worin man lange mit Unrecht eine dauernde Abhängigkeit der Instrumentalmusik von der Vokalmusik erkennen zu müssen glaubte, während im Gegenteil jetzt [um 1930] erkennbar wird, dass der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert aufkommende durchimitierende vokale A-cappella-Stil noch längere Zeit instrumentenmäßiges Figurenwerk aus der vorausgehenden Epoche beibehalten hat, das erst im Palestrinastil verschwindet. Mit den in Nachahmung der Motette und Chanson entstandenen Ricercari und Instrumentalkanzonen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zweigt sich dann wieder eine selbständige Instrumentalmusik ab, und das 17. Jahrhundert bringt die wirkliche Scheidung der Literaturen der Vokalmusik und Instrumentalmusik und damit auch die Möglichkeit, die technischen Spezialbedingungen der einzelnen Instrumente in höherem Maße auszunutzen, also zugleich auch wieder die Herausbildung von Spezialliteraturen der verschiedenen Instrumentalgattungen (Orgel (Klavier), Laute, Streichinstrumente, Blasinstrumente). Während man im 16. Jahrhundert für Streich- oder Blasinstrumente einfach die Stimmbücher der Vokalsätze auflegte, musste man ja doch für Laute oder Orgel (Klavier) erst aus den Stimmbüchern eine Tabulatur zusammenschreiben bzw. in Rücksicht auf die technischen Möglichkeiten (besonders für die Laute) ein förmliches Arrangement machen. Dabei ließ man die Gelegenheit nicht unbenutzt, in solchen Arrangements die Eigenart des Instruments auch in der Notierung zur Geltung zu bringen, und wir können aus den Verzierungen und Verschnörkelungen, welche der Lautensatz und Orgelsatz den bearbeiteten Vokalsätzen einfügen, schließen, wie etwa auch die zu vier und mehr zusammen musizierenden Streicher oder Bläser die Vokalsätze weiter ausschmückten, allerdings im Anschluss an ganz dieselbe Verzierungssucht auch der Sänger zu Ende des 16. Jahrhunderts, welche durch Werke wie die Bovicellis, Zacconis u. a. verbürgt ist. Einzelne ausfüllende Läufer, Triller usw. zeigen schon die Klavierintavolierungen von Chansons, die Attaingnant 1530 herausgab.
Diese Neigung zum solistischen Heraustreten der einzelnen Parte fand nun aber in den monodischen Formen der Musik seit 1600 eine der gesunden Weiterentwicklung der Kunst dienliche Ableitung in besondere Literaturgebiete. Der begleitete Sologesang erfuhr auf rein instrumentalem Gebiete sogleich im ersten Dezennium der Nuove musiche Nachbildung in den Solosonaten für Violine, Kornett oder irgendein anderes Melodieinstrument mit akkompagnierenden Fundamentinstrumenten. Ja selbst auf dem Gebiete der Literaturen der einzelnen Instrumente (besonders dem der Orgel) sind nun weitere Scheidungen deutlich zu erkennen, nämlich in eine Stilgattung mit einer einzigen dominierenden, reich verzierten Melodie und eine, welche den alten polyphonen Satz weiterführt. Dass von diesen beiden Stilgattungen die jüngere, die monodische, zunächst lange schwer zu ringen hatte, bis sie zu voll befriedigenden und dauernd lebensfähigen Formen durchdrang, ist gewiss nur natürlich. Mit der polyphonen Präambel-, Canzonen- und Ricercar-Literatur des 16. Jahrhunderts steht noch das Wohltemperierte Klavier Bachs mit seinen Fugen in festem Kontakt nach rückwärts, ist deren schönste Nachblüte. Dagegen bilden die ariosen Instrumentalsätze der Zeit Bachs die Fortsetzung der erst nach 1600 versuchten instrumentalen Monodie, welche nur ganz allmählich im Laufe des 17. Jahrhunderts von unbehilflichen, zerfahrenen und haltlosen Versuchen bei Sal. Rossi, B. Marini, C. Farina usw. zu logisch entwickelten ausdrucksvollen Kunstleistungen bei Legrenzi, Bassani, Vitali, Veracini, Corelli usw. sich auswachsen. Zwischen den vollstimmigen polyphonen Instrumentalsätzen und den instrumentalen reinen Monodien stehen aber vermittelnd durch das ganze Jahrhundert die zwei alternierende und gelegentlich zusammentretende Solostimmen über dem nur als Generalbass skizzierten Akkompagnement weiterführenden Triosonaten, welche besonders seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine hochbedeutende Literatur repräsentieren, die erst mit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der modernen Kammermusik aufgeht. Den hohen Wert dieser Literatur haben erst in neuester Zeit [um 1930] die Sammelwerke von G. Jensen (Klassische Violinmusik), H. Riemann (Collegium musicum) u. a. einigermaßen aufgedeckt; die Entwicklung der höheren Formen der Instrumentalmusik hat sich zum guten Teil in dieser Literatur vollzogen, und auch die Umbildung des herben, pathetischen Stils der altklassischen italienischen Violinmusik des ausgehenden 17. Jahrhunderts zu dem geschmeidigen, des buntesten Wechsels im Ausdruck fähigen Stile der Wiener Klassiker ist nirgends besser zu verfolgen als auf dem Gebiet der Triosonaten (Corelli, Abaco, Händel, J. S. Bach, Pergolesi, Fasch, J. G. Graun, Gluck; Fr. X. Richter, Johann Stamitz).
Die Bedeutung der französischen Lauten- und Klavierkomponisten vor 1700 für die Entwicklung der musikalischen Formen hat man stark überschätzt, solange man ihnen die Erfindung der Suite zuschrieb. Die Suite oder Partite (Partie) ist aber vielmehr deutschen Ursprungs und steht bereits um 1620 voll entwickelt da, sogar als Variationensuite (Peurl, Schein), zunächst als Folge von 4-5 mit Festhaltung derselben Motive gearbeiteten Tänzen (Pavane, Gaillarde, Courante, Allemande, Tripla) mit allmählich wachsender Zahl der Sätze und Aufnahme von Sätzen, die keine Tänze sind (Arien), seit 1650 (Ahle, Löwe, Becker, Reusner) mehr und mehr mit Voranstellung einer Sinfonia, Sonate (Sonatine), eines Präludiums statt der Pavane. Dieser Einleitungssatz ist zunächst ein der Pavane nahe verwandter Satz in zweiteiliger Liedform mit Reprisen, seit G. B. Buonamente (siehe dort) in Italien und seit Diedrich Becker (1668) und Johann Rosenmüller (1670) in Deutschland, aber allmählich allgemein eine mehrgliedrige italienische Kanzone, womit die Sonata da camera geschaffen ist (vgl. Suite).
Neben der Kammersonate entsteht aber seit 1682 (Kusser, Muffat, Joh. Fischer, Erlebach, Telemann, Fasch, Chr. Förster, Seb. Bach) eine in Nachahmung der aus Ouvertüren und Tanzstücken der Opern Lullys zusammengestellten Musiken zunächst durchaus für orchestrale Besetzung gemeinte neue Instrumentalform, welche die vier Normalsätze der Kammersonate (seit Froberger: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) nicht hat, sondern statt ihrer die neuen Tänze der Lullyschen Ballette und als Einleitung eine französische Ouvertüre (Orchestersuite, meist kurz französische Ouvertüre genannt), aber nicht aus Bühnenwerken entnommen, sondern sogleich für Konzertzwecke komponiert (!). Neben der alten Tanzsuite steht aber mindestens seit 1670 (Joh. Petzeld) in Deutschland die 2, 3, 4 und mehr zweiteilige Stücke mit Reprisen in derselben Tonart, aber verschiedener Taktart umfassende Partita ohne Tänze, eine Form, welche der zusammengestückten gleichzeitigen italienischen Kanzone (siehe unten) entschieden überlegen ist. Die deutsche Suite und das verwandte englische Consort sind von Anfang an vorzugsweise Ensemblemusik für 4, 5, 6 und mehr Stimmen. Erst nach 1650 treten häufiger auch dreistimmige Suiten auf, welche stärker auf Füllung durch den Generalbass rechnen. Die um 1600 in England einen starken Aufschwung nehmende Klaviermusik (vgl. Virginal-Musik) findet in Deutschland schnell Eingang und kräftige Nachfolge besonders durch J. J. Froberger, der aber zugleich die sehr wertvollen Errungenschaften der französischen Lautenmusik (Überwindung der kompakten Vollstimmigkeit durch freies figuratives Wesen) dem Klavier zuführt und die Klaviersuite schafft (die Virginalisten kennen die Suitenform noch nicht). Eine Spezialliteratur aber mit den Formen der Ensemble-, Lauten- und Klaviermusik entwickelt sich im 17. Jahrhundert für Gambe (Marais, Schenck, Chr. Simpson, Kühnel, Hesse), und auch die in ihren Mitteln beschränktere Violine versucht sich ganz zu emanzipieren durch raffinierte Ausbildung des doppelgriffigen Spiels (Baltzer, Biber, J. J. Walther, Strungk). Die erste Ausbildung des kleinen Genrestücks (Charakterstücks, auch gleich mit prägnanten Überschriften) ist das Verdienst der französischen Lautenisten (Denis Gaultier) und Clavecinisten (Couperin, Rameau). Die deutsche Suite besteht gleich zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus einer Anzahl gegeneinander abgeschlossener, in derselben Tonart stehenden Stücke. Dagegen war die in Italien seit dem Ende des 16. Jahrhunderts gepflegte Kanzone (Canzon francese, C. da sonar) ein aus bunt kontrastierenden Bruchstücken verschiedenen Tempos und verschiedener Taktart zusammengefügtes, in einem Zuge zu Ende gespieltes Werkchen. Die Zahl dieser Teile war anfänglich oft sehr groß (5, 7, 10 und mehr), die Teile zeigten teils den Charakter von Tanztypen (Pavane, Gaillarde), teils die imitierende Arbeit des Ricercar. Das Modell dieser Instrumentalkanzone war die neue französische Chanson der Epoche Janequin mit ihren kecken Stimmungs- und Taktwechseln (Attaingnants Chanson-Ausgaben seit 1529). Durch Verringerung der Anzahl der Teile und die Festhaltung weniger Themen wuchsen die Teile zu größeren Dimensionen und lösten sich allmählich durch förmliche Schlüsse voneinander los. Die Einleitungsstücke der italienischen und der französischen Opern (Lullys Ouvertüre, Scarlattis Sinfonia) sind nur zwei Typen der auf drei Teile beschränkten Kanzone oder Sonate. Auch das ebenfalls seit Ende des I7. Jahrhunderts aufblühende italienische Konzert, sowohl das dem Tutti ein kleines Soloensemble gegenüberstellende Concerto grosso als die nur auf starke Besetzung berechnete, ebenfalls Concerto genannte Orchestersonate ("starke Sonate", Mattheson) und das nach 1700 erblühende Solokonzert sind nichts anderes als solche auf drei Sätze beschränkte Formen der alten Kanzone und Sonate.
So erwächst schließlich mehr durch eine Wandlung des Stils (siehe oben) als durch Veränderung der Formen (vgl. aber Sonate) aus den mancherlei aufgewiesenen Gebilden der älteren Instrumentalmusik um 1750 die moderne Sinfonie und die gesamte Kammermusik und verdrängt zunächst schnell die französische Ouvertüre aus der allgemeinen Gunst. Die Sonaten, Trios, Quartette für Klavier und einfach besetzte Streichinstrumente von Fr. X. Richter, Johann Stamitz, Schobert, Eichner, Joh. Christ. Bach, Karl Stamitz und der Wiener Schule führen direkt über zu Mozart und Haydn. Die Literatur der (einfach besetzten) Streichtrios und -quartette, -quintette schaffen auf dem Boden der von den Italienern, Wienern, von Joh. Stamitz und Fr. X. Richter gegebenen Anregungen Haydn, Boccherini und Mozart. Die Entwicklung geht nun mit Riesenschritten vorwärts. Die Begleitung war in ihrer schönsten Bedeutung erkannt und ihr die Aufgabe zugewiesen, den harmonischen Gehalt der Melodie zu erschließen. So vertiefte sich die Ausdrucksfähigkeit der Instrumentalmusik immer mehr, besonders als der mächtige Schöpferdrang Beethovens sich fast ausschließlich der Instrumentalmusik zuwandte und neue Saiten von erschütterndem Klange anschlug. Durch die nun schon drei Jahrhunderte andauernde Verbindung der Instrumentalmusik mit dem gesungenen Drama (Oper) hat sich eine Gefühls- und Illustrationsmusik von so unzweideutiger Prägung des Ausdrucks entwickelt, dass es jüngste Meister unternehmen konnten, rein instrumentale Werke aufzustellen, welche bestimmte Charaktere, ja Situationen, psychologische Vorgänge und Naturereignisse zeichnen. Vgl. Programmmusik. In der "Neuen Musik" ist dann eine Reaktion auf die romantische und programmatische Instrumentalmusik erfolgt und hat sich wieder ein "rein musikalisches" oder konstruktives Ideal entwickelt. Mit den Veränderungen der Formen verändert sich auch im Laufe der Jahrhunderte das Klangideal der Instrumentalmusik. Ganz im Allgemeinen kann man sagen, dass der "stillen Musik" früherer Jahrhunderte um 1800 eine Neigung zum schärferen Kontrast gefolgt ist; damit hängt ein vielfältiger Wandel der instrumentalen (orchestralen) Einkleidung zusammen.
Über die ältere Geschichte der Instrumentalmusik vgl. Schering, Studien zur Geschichte der Musik der Frührenaissance (1914), Wasielewski, Gesch. d. I. im 16. Jahrh. (1878) und Die Violine im 17. Jahrh. (1874); Fr. Blume, Studien zur Vorgeschichte der Orchestersuite (1925); Andreas Moser, Gesch. des Violinspiels (1923); H. Riemann, Das Kunstlied im 14.-15. Jahrh. (Sammelb. d. IMG. VII, 4; 1906), Die Variationenform in der alten deutschen Tanzsuite (Musik. Wochenblatt 1895), Die französische Ouvertüre zu Anfang des 18. Jahrh. (das. 1898), Die Mannheimer Schule (DTB., III, I), Mannheimer Kammermusik (das., XV), und Johann Schobert (DdT., Bd. 39); L. Torchi, La musica instrumentale in Italia nei secoli 16., 17. et 18. (Rivista musicale 1897ff, auch separat); Ad. Sandberger, Zur Geschichte des Haydnschen Streichquartetts (Altbayr. Monatsschrift 1900) und desselben Einleitung zur Ausgabe der Werke Abacos (DTB., Bd. I 1900); Karl Nef, Zur Geschichte der deutschen Instrumentalmusik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Beiheft 5 der IMG. 1902); Max Seiffert, Geschichte der Klaviermusik (I. Bd. 1899); Alfr. Einstein, Zur Geschichte der deutschen Literatur für Viola da Gamba (1905); G. Beckmann, Das Violinspiel in Deutschland vor 1700 (1918); W. Danckert, Geschichte der Gigue (1924); K. Mennicke, Hasse und die Brüder Graun als Symphoniker (1906); Ch. Van den Borren, Les origines de la musique de clavier en Angleterre (1912) und Les origines de la musique de clavier aux Pays-bas (1914); O. Kinkeldey, Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts (1910); M. Brenet, Notes sur l'histoire du luth en France (1899) und Les concerts en France sous l'ancien régime (1900); A. Schering , Geschichte des Instrumental-Konzerts bis auf die Gegenwart (1903); H. Botstiber, Geschichte der Ouvertüre (1913); Karl Nef, Geschichte der Symphonie und Suite für Orchester (1921). [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 803ff]