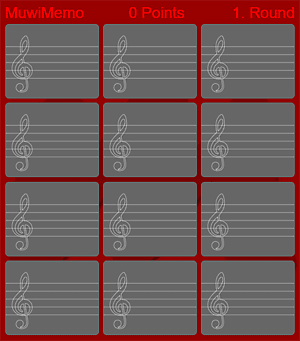Fagott (1929)
Fagott (italienisch: Fagotto, französisch: Basson, englisch: Bassoon), eins der dem heutigen Sinfonieorchester angehörigen Holzblasinstrumente. (Die angebliche Autorschaft des Kanonikus Afranio degli Albonesi zu Ferrara, 1525, für die Erfindung des Fagotts (fagotto = Bündel) hat mit dem Fagott gar nichts zu tun, da sein von seinem Neffen Teseo Albonesio in seiner Introductio in chaldaicam linguam, 1539, beschriebener Phagotus ein unförmliches, durch Bälge mit Wind versorgtes Instrument ist. Vgl. L. Fr. Valdrighi, Sincrono documento intorno al metodo per suonare il Phagotus d'Afranio i. d. Memorien der Akademie der Wissenschaften zu Modena 1895).
Wegen der viel sanfteren Intonation wurde das Fagott lange noch Dolcian (Dulcian) genannt. Das Fagott gehört zu den Instrumenten mit doppeltem Rohrblatt (wie schon die alten Schalmeien und Bomharte und wie heute die Oboe und Englisch Horn); das Rohr wird auf den S-förmig gewundenen Hals des Instruments geschoben. Der Bläser nimmt das Doppelblatt direkt zwischen die Lippen (während die Hautbois de Poitou, Nicoli, Krummhörner, Cornamuse und Schryari Mundkapseln mit einem Anblaseschlitz hatten), wodurch er den Ausdruck des Tons ganz in die Gewalt bekommt.
Das Fagott hat sich sehr langsam entwickelt. Wesentliche Verbesserungen des Mechanismus haben erst um 1824-35 K. Almenräder, Schmidtbach in Hannover und Joh. Adam Heckel (gest. 1877) in Mainz (Biebrich) gemacht; die Zahl der Klappen stieg von 2 (im 17. Jahrhundert) bis auf 18. Der Umfang des heutigen Fagotts reicht vom (Kontra-B) ,B bis zum (zweigestrichenen) c'', auf den [um 1930] neuesten Instrumenten bis es". Virtuosen bringen auch noch e'' und f'' heraus, doch ist die gewöhnliche Grenze für den Orchestergebrauch b'. Ein weiches Blatt begünstigt die Ansprache der tieferen, ein hartes die der höheren Töne. Die Unterscheidung des ersten und zweiten Fagotts im Orchester ist daher vom Komponisten wohl zu berücksichtigen. Die Klangfarbe des Fagotts hat, obwohl es auch der edelsten Kantilene fähig ist, etwas Näselndes; es spielt nicht selten die Rolle des Komikers im Orchester. Das Quintfagott (Tenorfagott), heute fast ganz verschwunden, steht eine Quinte höher (tiefster Ton F), das Kontrafagott eine volle Oktave tiefer als das Fagott. In Bachs 1715 geschriebener Kantate 150 (Nach dir, Herr, verlanget mich) ist ein Fagotto ex D gefordert, das aber richtiger ex A hieße, da es wie Hautbois d'amour um eine kleine Terz höher notiert ist, als es klingt.
Fagottschulen schrieben Ozi, Nouvelle méthode… (1787 und 1800, auch in neuer deutscher Ausgabe), Cugnier, Blasius, Fröhlich, Küffner, Kling, R. Hoffmann. Vgl. W. Heckel (Sohn und Nachfolger von J. Ad. Heckel), Der Fagott (1899). Vgl. auch Oboe (Bariton-Oboe, Heckelphon). Auch eine Orgelstimme heißt Fagott. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 484f]