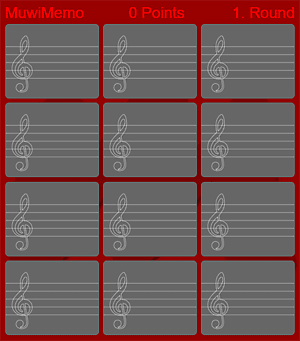Verwandtschaft der Töne und Tonarten (1865)
Verwandtschaft der Töne und Tonarten, die näheren oder ferneren Beziehungen und Verhältnisse, in welchen die Töne unseres ganzen Tonsystems zueinander stehen. Auf Grund dieser Verwandtschaft schließen sie sich zu gewissen Tonkreisen zusammen, welche von den nicht in dieselben hineingehörigen Tönen, ohne Störung der tonalen Harmonie, entweder gar nicht oder nur auf dem Wege der Vermittlung betreten werden können.
Die verwandtschaftliche Beziehung der Töne zueinander ist nun eine sehr mannigfaltige, die Ausgangspunkte für alle derselben bietet aber die in einem jeden Tone mitklingende Reihe seiner harmonischen Obertöne (siehe Klang). Die aus dem Grundton zunächst entspringende Oktave, das Schwingungsverhältnis 2:1, muss zu ihm, als einfachstes Zahlenverhältnis und reinste Konsonanz, im nächsten Grade der Verwandtschaft stehen. Darauf folgt die Quinte 3:2 und im Verhältnis der Doppeloktav zur Quinte, die Quarte 4:3. Diese Verhältnisse der Quinte und deren Umkehrung, der Quarte, liegen, als die vom Grundtone zuerst erzeugten, allen Tonverwandtschaften in erster Reihe zu Grunde, und zwar ist die Beziehung der Quint zum Grundtone eine noch nähere als die der Quart.
Im ferneren entspringen aus dem Grundtone die große Terz 5:4 und die kleine Terz 6:5, welche in Verbindung mit Grundton und Quinte das Fundament aller gleichzeitigen Tonverbindung, den großen [Dur] und kleinen [Moll] Dreiklang, ausmachen. Durch Umkehrung der Terzen entstehen die Sexten, in den höheren Verhältnissen 9:8 und 10:9 erscheint der Ganze Ton in zwei verschiedenen Modifikationen, und in den noch höheren 15:8 die große Septime und 16:15 der diatonische Halbton.
Diese Reihe der mitklingenden Töne gestaltet sich durch stufenweise fortschreitende Ordnung zur Tonleiter, der melodischen Form der Tonart, deren sämtliche Töne nun auf Grund ihrer gemeinsamen Beziehung auf denselben Grundton auch zueinander in verwandtschaftlichen Verhältnissen stehen müssen. Wir können die einer Tonart angehörenden (ihr leitereigenen) Töne auf jede beliebige Weise melodisch und harmonisch miteinander verbinden, ohne jene Beziehungen zu ihrem Grundton aufzuheben. Doch ist ihr Verhältnis zum Grundton ein näheres oder entfernteres, je nachdem sie in einfacheren oder zusammengesetzteren Zahlenverhältnissen zu ihm stehen. Die ihm nächstverwandten Töne, Quint und Quart (Unterquint), nehmen die bevorzugte Stellung in der Tonart ein, daher sie Dominanten (siehe dort) genannt werden. Ihre Akkorde repräsentieren mit dem tonischen Dreiklang den Inbegriff der Tonart in harmonischem Sinne, indem alle Intervalle derselben in diesen drei Dreiklängen (den Hauptakkorden, siehe dort und Dreiklang) zusammenklingend erscheinen.
Die Durskala erscheint durch die beiden Dominanten in zwei gleichgestaltete Tetrachorde geteilt, von denen jedes dem andern hinsichtlich der Lage des diatonischen Halbtones vollkommen ähnlich ist:
C-D-E^F | G-A-H^cund die nächste Verwandtschaft der Tonarten unter sich gründet sich auf dem Enthaltensein eines der beiden Tetrachorde auch in einer andern Tonart. Jedes der beiden Tetrachorde findet sich nur in einer einzigen andern Tonart wieder, das obere G-A-H^c in der Tonart G-Dur und das untere [C-D-E^F] in der Tonart F-Dur. Diese beiden Nebentonarten, von welchen die obere, auf der Oberquint der Haupttonart begründet, die vier oberen Stufen der letzteren als ihre vier unteren Stufen enthält, während die untere, auf der Unterquinte der Haupttonart beruhend, die vier unteren Stufen derselben als ihre vier oberen Stufen in sich begreift, sind die Dominanttonarten. Die Dominanttonart G-Dur unterscheidet sich von der Haupttonart C-Dur nur durch ihre große Septime Fis, die Unterdominanttonart durch ihre Quarte B:
Auf dieselbe Art setzt sich die Verwandtschaft der Tonarten fort. Nimmt man die Tonart G-Dur als Haupttonart an, so erscheinen D- und C-Dur, nimmt man F-Dur an, C- und B-Dur als Dominant- und Unterdominanttonarten im nächsten Verwandtschaftsgrade zur Haupttonart G-Dur [bzw. F-Dur]. Die beiden Dominanttonarten einer Haupttonart stehen aber zueinander in bereits entfernteren und nur in der gemeinsamen Haupttonart wurzelnden Beziehungen, weshalb sie auch nicht in unmittelbare Verbindung miteinander treten, sondern eine Vermittlung durch die Haupttonart fordern, siehe Tonart. Ähnliches gilt von den Akkorden der Dominanten, deren Verhältnis zueinander ebenfalls nur in ihrer gemeinsamen Beziehung auf einen Grundton beruht. Der tonische Dreiklang vermittelt sie, ihre unmittelbare Aufeinanderfolge macht sich als harmonischer Sprung fühlbar.
Eine andere Art von Tonartenverwandtschaft als jene auf das Dominantverhältnis begründete, aber ebenfalls sehr nahe, findet statt zwischen den sogenannten Paralleltonarten, d. h. zwischen der Durtonart und der auf ihrer Untermediante errichteten Molltonart. Die Parallelmolltonart besteht aus denselben Tönen wie die Durtonart, nur dass die Intervallordnung derselben eine andere ist, worüber man unter Tonart vergleichen möge. Endlich gehören zum Verwandtenkreise einer Tonart die Nebentonarten oder leiterverwandten Nebentonarten, d. h. diejenigen Tonarten, denen die leitereigenen Dreiklänge der Haupttonart als tonische Dreiklänge zu Grunde liegen, und deren es, neben den ebenfalls dazugehörigen Dominanttonarten und der Paralleltonart, noch mehrere gibt. Je nach Umständen sind es Dur- oder Molltonarten, aufgenannt findet man sie im Artikel Nebentonarten. Ihr Auftreten als leiterverwandte Modulation wird durch ihre Dominantakkorde vermittelt, siehe Ausweichung.
Die Verwandtschaft der Akkorde beruht auf denselben Verhältnissen wie die der Tonarten. Die Dominantakkorde (siehe oben) und der Akkord der Paralleltonart sind dem tonischen Dreiklang in erster Reihe verwandt; die übrigen leitereigenen Dreiklänge können mit ihm entweder ebenfalls unmittelbar in Verbindung gebracht oder durch einen der Dominantakkorde vermittelt werden. [Dommer Musikalisches Lexicon 1865, 920f]