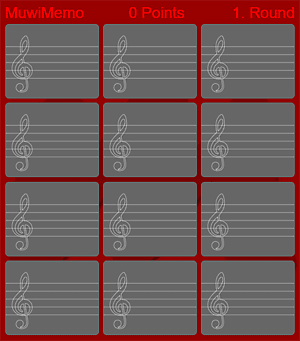Moll (1929)
Moll, das dem Dur gegensätzliche Tongeschlecht, das einen dunkleren, weicheren, gern als "weiblich" bezeichneten Charakter hat. Dieser gegensätzliche Charakter rührt davon her, dass im Durakkord (siehe dort) die in einfachsten Verhältnissen bezüglich der Schwingungszahlen stehenden Töne zur Einheit des Klanges zusammengefasst werden, in Moll dagegen die in einfachsten Verhältnissen bezüglich der Schallwellenlängen stehenden (vgl. Klang). Ganz verkehrt ist es, Moll von Dur abzuleiten und Dur als das Ursprüngliche, Moll als das Sekundäre, Künstliche zu betrachten.
Die Entstehung der Namen Dur und Moll hat mit diesen ästhetischen Unterschieden zunächst gar nichts zu tun. Das lateinische molle ("weich") wurde (wohl zuerst von Odo von Clugny im 10. Jahrhundert) zur Bezeichnung des runden B (♭, B molle oder B rotundum) im Gegensatz zum eckigen (
, B durum, B quadratum, unser h) gebraucht. Der Name Moll wurde dann übertragen auf das Hexachord f-d, welches nicht h, sondern b benutzte (Cantus mollis, siehe Solmisation), und ging gegen Ende des 17. Jahrhunderts allgemein auf die Tonart und den Akkord mit kleiner Terz über. Noch in Werckmeisters Musicalische Temperatur (1691) ist a mol [sic] so viel wie as (as als Mollterz von f). Vgl. Riemann, Geschichte der Musiktheorie, S. 440f. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 1194]