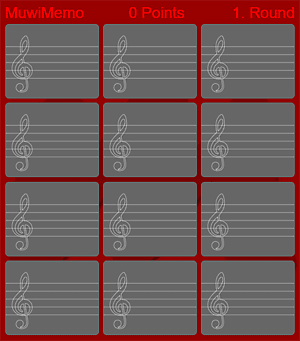Niederländische Schule. Es ist Im Artikel Kanon gezeigt worden, auf welchem natürlichen Wege der gregorianische Gesang zur Mehrstimmigkeit geführt wurde. Bis in das 12. Jahrhundert hinein wurde diese überall aus dem Stegreif geübt. Die Kunst zu diskantisieren, d. h. dem Cantus firmus eine andere selbständige Stimme gegenüber zu stellen, war eine Disziplin des Gesangunterrichts. Die Gesangschüler lernten nicht nur die Gesänge des kirchlichen Ritus singen, sondern sie erhielten zugleich Anweisung, diese durch selbständige Stimmen zu kontrapunktieren. Diese Weise des Diskantisierens kam namentlich in Frankreich als Déchant und Dechantisieren in hohe Blüte und einzelne Sänger in Paris, wie Tapissier, Carmen und Cesaris zeichneten sich als Déchanteurs so aus, dass sie bei ihren Zeitgenossen höchste Bewunderung erregten. Die sogenannten Falso bordoni und Faux bourdons brachten die römischen Sänger aus Avignon nach Rom mit und die erhaltenen Proben von mehrstimmigen Gesängen aus dem 13. Jahrhundert geben den Beweis, dass in dieser Zeit schon gewisse feste Stützpunkte für die Entwicklung der Harmonik gewonnen waren.
Doch erst nachdem die Theoretiker aus diesen Experimenten gewisse feste Regeln für Verwendung der verschiedenen Intervalle auch als Zusammenklänge gewonnen hatten, wurde durch die niederländischen Meister diese ganze Entwickelung in bestimmte Bahnen geleitet, an Stelle der Improvisation das nach künstlerischen Prinzipien geformte Kunstwerk gesetzt. Guilelmus Dufay (gestorben 1432), der erste bedeutende Meister dieser Schule, der die Nachahmungsformen schon mit großer Freiheit zu behandeln versteht, wurde auch bahnbrechend für die Entwickelung der Mensuralnote. Seine frühesten Chansons sind noch mit der geschwärzten Note aufgezeichnet. Später bediente er sich der weißen und er gewann dann durch die ganze oder teilweise Schwärzung der Noten neue Mittel der Veränderung des Rhythmus. Von seinen kirchlichen Tonstücken sind nur wenige bekannt geworden, aber diese zeigen ebenso viel Meisterschaft in der Beherrschung des Materials, wie fromm religiöse Empfindung. Seine Chansons sind noch meist dreistimmig, seine Messen dagegen vierstimmig, mit zwei- und dreistimmigen Sätzen untermischt. Neben ihm und in seinem Sinne wirkten Egydius Binchois, Vincenz Faugues, Eloy, Anton Busnois, die namentlich die Nachahmungsformen mit größerem Eifer förderten. Ferner sind noch Hayne, Firmin Caron oder Carontis u. a. zu nennen. Einen ersten Abschluss in die technischen Künste dieser Schule brachte Johannes Ockeghem oder Ockenheim, der dadurch und durch den Einfluss, den er damit auf seine Zeitgenossen gewann, den Titel eines Fürsten der Musik zuerst erhielt (gestorben wahrscheinlich 1513). Er erscheint als der Gipfelpunkt der gesamten Theorie von Hugbald bis auf Johann de Muris und Marchettus von Padua. Am nächsten kommt ihm von seinen Zeitgenossen Jakob Hobrecht oder Obrecht, Obertus, Obreht (geboren 1430, gestorben 1507), der durch seine zahlreichen Messen und Motetten wie durch seine Lieder einen hervorragenden Platz in der Musikgeschichte gewann. Von den Schülern Ockenheims: Josquin de Prés, Antonius Brumel, Alexandre Agricola, Pierre de la Rue, Loyset, Compère, Gaspard, Verbonnet und Prioris ist Josquin (gestorben 1521) der bedeutendste, der der Schule eine neue Entwickelung begründete. Neben ihnen und den Schülern Josquins: Coclicus, Mouton, Arcadelt, Gombert, Isaak usw. sind noch eine ganze Menge von Zeitgenossen zu nennen, wie Johannes Ghiselin de Orte, Matthäus Pipelare, Nicolaus Craen, Lupus, Antonius Divitis und eine Reihe anderer, die im Sinne und Geiste der niederländischen Schule wirkten und ihr den ungeheuren Einfluss auf die Entwicklung der gesamten Musik mit sichern halfen, namentlich aber Antonius de Fevin, Eleazar und Genét, genannt Carpentras, Adrien Petit, genannt Coclicus, und Heinrich Isaak (Arrigo Tedesco) verpflanzten diese Weise der niederländischen Schule nach Deutschland, Willaert nach Italien, Certon, Clement Jannequin, Maillart, Bourgogne, Moulu nach Frankreich.
Wie sie dort in Italien in der venetianischen Schule und dann in der römischen neue Richtungen einschlug, ebenso wie in Deutschland, und dann in Palestrina und Orlandus Lassus ihre höchsten Ziele erreichte, und zugleich in Deutschland wieder in ganz neue Bahnen geleitet erscheint, ist hier nicht weiter zu erörtern. [Reissmann Handlexikon 1882, 318f]