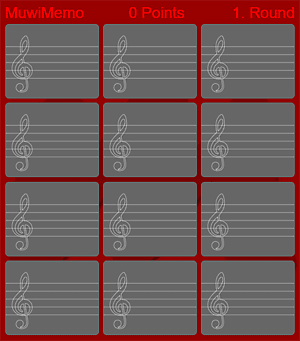Clarino, Clarin blasen (1929)
Clarino,
- italienisch, so viel wie Trompete, in Deutschland früher Name der hohen Solotrompete, die sich nur durch ein engeres Mundstück von der tieferen (Prinzipal-) Trompete unterschied. Clarin blasen ist in der Trompeterkunst des 17.-18. Jahrhunderts so viel wie hohe Solotrompete blasen; Prinzipal blasen so viel wie tiefe Trompete blasen. Der Basspart der Trompetensätze (der eigentlich der Pauke angehört!) heißt Toccato. Die Trompete ging damals erheblich höher als heute (bis d3). Wir würden an den dünnen, spitzen Tönen der höchsten Trompetenlage keinen Geschmack mehr finden. Vgl. Joh. Ernst Altenburg, Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikal. Trompeter- und Paukerkunst (1795, Kap. XI: Vom Clarinblasen und von dem dazu erforderlichen Vortrage, auch das daselbst S. 131ff. mitgeteilte Concerto a VII Clarini con Tymp.) sowie H. Eichborn, Die Trompete alter und neuer Zeit (1882) und Das alte Clarinblasen auf Trompeten (1894).
- Name des durch Überblasen der Töne des Schalmeiregisters in die Duodezime hervorgebrachten mittleren Registers der darum so genannten Klarinette (h1-c3). Das neue Instrument erbte Namen und Rolle des Clarin [sic].
- In der Orgel so viel wie 4-Fuß-Trompete, Oktavtrompete (französisch: Clairon, Clarin, englisch: Clarion).