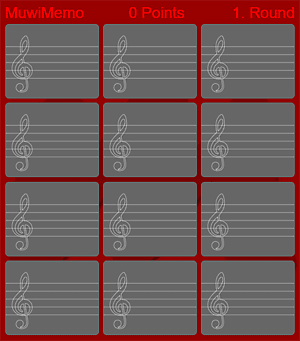Dreiklang (1929)
Dreiklang (lateinisch: Trias), eigentlich nur so viel wie ein aus drei verschiedenen Tönen bestehender Zusammenklang, doch stets nur im engeren Sinne gebraucht für die aller harmonischen Auffassung zugrunde liegenden aus Prim, (großer) Terz und (reiner) Quinte nach oben oder nach unten bestehenden konsonanten Harmonien, den Dur-Akkord und Moll-Akkord (Trias harmonica, italienisch: Accordo perfetto, französisch: Accord parfait, englisch: Common chord). Zwar spricht man auch von übermäßigen und verminderten Dreiklängen und noch einigen anderen dissonanten Abarten des Dreiklangs, erklärt sie aber durch die Zusätze übermäßig und vermindert usw. von dem konsonanten Dreiklang aus. Nur der Schematismus des Terzenaufbaues der Generalbasssisten brachte es gegen Ende des 18. Jahrhunderts fertig, für den verminderten Dreiklang (z. B. für h-d-f) sogar Konsonanz in Anspruch zu nehmen (Kirnberger; vgl. Riemann, Gesch. d. Musiktheorie, II. Aufl., S. 496). In der Generalbassbezifferung ist, seit ihrem Aufkommen um 1600, bei Fehlen jedes Zeichens der leitereigene Dreiklang der allein selbstverständliche Akkord; dass man von Anfang an nur den Dur-Akkord und den Moll-Akkord als richtige Dreiklänge anerkannte, geht aus den mancherlei eigentlich überflüssigen Zeichen hervor, welche man anwandte, wo man den (leitereigenen) verminderten Dreiklang eingeführt sehen wollte (5♭,
5, 5). Dass der verminderte Dreiklang gewöhnlich als unvollständiger Septimenakkord zu verstehen ist, erkannte zuerst Rameau, der überhaupt den Grund legte zu einer rationellen Lehre von der Harmoniebedeutung der Akkorde. Vgl. Funktionsbezeichnung. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 425f]