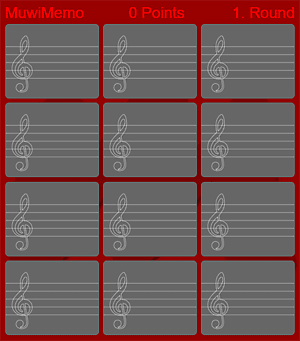Melodik (1929)
Melodik ist die Lehre von der geordneten Folge der Töne in der Musik, wie Harmonik die Lehre von den verständlichen Zusammenklängen der Töne ist. Das letzte Prinzip des Melodischen ist die Veränderung der Tonhöhe nach oben oder unten (Steigen oder Fallen), und zwar zunächst nicht die sprungweise, sondern die stetige, allmählich geschehende. Im Banne der Harmonik wird aber die Tonhöhenveränderung zu einer stufenweisen. Die im engsten Kreise um einen Ton hin und her gezogenen primitiven Gesänge von Naturvölkern lassen vielfach Intervalle bestimmter Größe noch nicht erkennen, haben vielmehr ihr Wesen nur in dem Auf- und Abschwanken der Tonhöhe. Aber auch auf fortgeschrittenen Stufen der Musikübung ist den kleinsten Intervallen am stärksten die rein melodische Wirkung eigen, und es heißen daher mit Recht die Sekundschritte (der diatonische und chromatische Halbton und der Ganzton) melodische Intervalle, und eine von der Chromatik (Halbtonfolge) stärkeren Gebrauch machende Melodik wird daher "naturalistisch" genannt, weil sie der stetigen Tonhöhenveränderung am nächsten kommt, während größere Schritte (Terz, Quarte, Quinte usw.) das Interesse auf die harmonischen Beziehungen der Töne lenken, welche das Material der eigentlich künstlerischen Gestaltung bilden. Das Steigen der Tonhöhe ist als gesteigerte Lebendigkeit eine Steigerung, das Fallen als verminderte Lebendigkeit eine Abspannung. Die melodische Bewegung gleicht daher den Bewegungen der Seele in Affekten: Die positive Bewegung (Steigung) entspricht dem Sehnen, Begehren, Streben, Wollen, Anstürmen usw., die negative (Fall) dem Entsagen, Verzagen, der Einkehr in sich selbst, Beruhigung.
Diese elementaren Wirkungen haften, wie gesagt, zunächst nur an der nackten Tonhöhenveränderung, wie man sich z. B. an dem Sturmgeheul (oder z. B. den dasselbe nachahmenden chromatischen Gängen im Fliegenden Holländer) klarmachen kann. Die Melodie als wohlgeordnete Reihe harmonisch gegeneinander verständlicher (abgestufter) Töne hat einen Teil jener elementaren Wirkung eingebüßt gegen die ästhetisch freilich viel höher anzuschlagenden Verstrickungen der harmonischen Beziehungen (das Melodische ist stilisiert). Doch erkennt schon Aristoxenos, dass auch die stufenweise Tonhöhenveränderung durch die Phantasie des Hörenden in eine stetige verwandelt wird. Vgl. Riemann, El. d. mus. Asthetik, S. 38ff.
Eine für die Praxis berechnete Lehre der Melodiebildung hätte sich zu befassen:
- mit der Begründung der diatonischen Tonleitern als der leichtest verständlichen Schemata der an Stelle der stetigen Tonhöhenveränderung tretenden abgestuften;
- mit der Untersuchung der verschiedenartigen melodischen Ausfüllung eines Akkords je nach seiner Stellung in der Tonart;
- mit den einfachsten Elementen der musikalischen Formenlehre (Motivbildung, Motivverkettung, Imitation).
Zurzeit [um 1930] existiert ein Kursus "Melodielehre", der die Materie vom Prinzip aus systematisch entwickelte, an den Musikschulen und in Lehrbüchern nicht, sondern die Elemente der Melodielehre werden notdürftig in der Harmonielehre abgehandelt, und die höheren Stufen in der Kompositionslehre. Als Versuche der Anbahnung einer eigentlichen Melodielehre sind zu nennen: Jos. Riepel, Tonordnung…, drei Teile (1755, 1757, 1765); Nichelmann, Die Melodie… (1755); Reicha, Traité de mélodie, 1814 (1832); L. Bußler, Elementarmelodik (1879); H. Riemann, Neue Schule der Melodik (1883) und Katechismus der Kompositionslehre (4. Aufl. 1910, 1. Teil, 1. Kapitel); E. Cremers L'analyse et la composition mélodique (1898); H. Rietsch, Die deutsche Liedweise (1903); Ernst Toch, Melodielehre (1923); Paul Kiebs, Von der Melodie und dem Aufbau der musikalischen Formen (1928); Karl Scheffler, Die Melodie (1919); Ernst Hoffmann, Das Wesen der Melodie (1924). Vgl. auch Mey und Ernst Kurth. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 1149f]