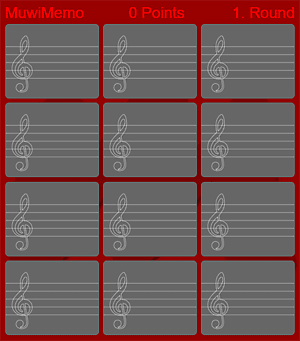Organum (1929)
Organum griechisch: ὄργανον [organon], bedeutet
1) zunächst nur Werkzeug (Organ), spezieller aber Musikinstrument und dann das "Instrument der Instrumente", die Orgel (siehe dort).2) die älteste und primitivste Art mehrstimmigen Musizierens, über deren wahre Natur lange eine irrige Meinung verbreitet war. Wie Hugo Riemann in seiner Geschichte der Musiktheorie, S. 17ff, nachgewiesen hat, ist das Organum nichts anderes als ein wechselndes Auseinandertreten zweier Stimmen vom Einklang aus bis zur Quarte und wieder Zurücklaufen in den Einklang bei allen Teilschlüssen der Melodie, die älteste Form des improvisierten Kontrapunkts zu den Melodien der Kirchengesänge. Die Gegenstimme liegt beim ältesten Organum stets unter dem Cantus firmus. Die älteste Lehrabhandlung (die Musica enchiriadis) lehrt allerdings das Organum auch als fortgesetzten Parallelgesang, sogar in Quinten mit Oktavverdoppelung beider Stimmen, und scheint damit eine Zeit lang durchgedrungen zu sein, so dass noch Guido von Arezzo das Quinten-Organum bekämpfte; d. h. er zieht das nicht parallele dem parallelen Organum vor.
Von Anfang an scheint der einen (nicht parallelen) Art des Organums der Stillstand der Organalstimme auf gewissen Tönen (C, F und G) eigentümlich gewesen zu sein, und bis in die Zeiten der ersten Mensuralkomponisten hinein, ja darüber hinaus bis ins 14. Jahrhundert (Muris) haben sich unter dem Namen Organum Formen der mehrstimmigen Komposition erhalten, deren Eigentümlichkeit lange Haltetöne der Unterstimme ("Orgelpunkte", organici punctus) sind. An Stelle des Einklangs bei den Teilschlüssen tritt um 1100 auch die Oktave. Die Kreuzung der Stimmen lehrt schon Guido, und der Engländer Joh. Cotton führt bereits direkt vom Organum zu dem eigentlichen Discantus (siehe dort) über.
In neuester Zeit hat Peter Wagner (Über die Anfänge des mehrstimmigen Gesangs, ZfMW. IX, 1, 1926) als älteste, dem Organum um zwei Jahrhunderte vorangehende südeuropäisch-römische Übung der Mehrstimmigkeit, d. h. des Zusammensingens in Quinten und Quarten neben der Oktave, die sog. Paraphonie nachzuweisen gesucht, die schon im 7. Jahrhundert in Rom gepflegt worden sei. Vgl. P. Wagner, Zu den liturgischen Organa (AfMW. VI, 1; 1924); Zum Organum Crucifixum in carne (ibid. VI, 4; 1924); J. Handschin, Zum Crucifixum in carne (ibid. VII, 2; 1925); derselbe, Zur Geschichte der Lehre vom Organum (ZfMW. VIII). [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 1312f]