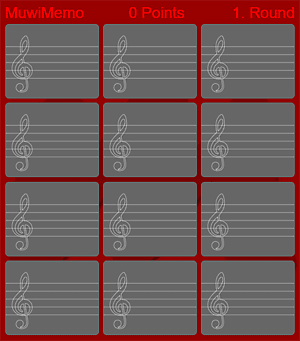Flageolett (1929)
Flageolett (französisch),
1) ein kleines Blasinstrument, der letzte Vertreter der Schnabelflöten (siehe Flöte), in Belgien, Frankreich und England noch jetzt [um 1930] in untergeordneten Orchestern gebraucht, von der Tonlage der Pickelflöte, d. h. eine Oktave höher als die gewöhnliche (Quer-)Flöte stehend.2) Eine kleine Orgelstimme (zu 2 und 1 Fuß), ein Flötenregister von ziemlich enger Mensur.
3) Bezeichnung für die durch Teilschwingungen der Saiten hervorgebrachten hohen Töne der Streichinstrumente (Flageolett-Töne), welche einen eigentümlich pfeifenden, aber weichen, ätherischen Klang haben, der von dem Kratzgeräusch der sonstigen Töne dieser Instrumente frei ist.
Das Flageolett wird für besonders hohe Noten oft auch bequemlichkeitshalber angewandt, was aber wegen des Unterschiedes der Klangfarbe nicht unbedenklich ist. Flageolett wird erzeugt, indem leise mit der Fingerspitze der Punkt der Saite berührt wird, welcher genau der Hälfte, dem Drittel oder Viertel usw. der Saite entspricht; diese schwingt dann nicht in ihrer ganzen Länge, sondern in 2, 3, 4 usw. Abteilungen, deren jede selbständig den betreffenden Oberton hervorbringt. Andere als die natürlichen Obertöne der Saiten erscheinen als Flageolett, wenn zunächst durch festen Griff (vgl. Sattel) die Saite so weit verkürzt wird, dass der gewünschte Ton in der Obertonreihe des nunmehrigen Tons der Saite liegt, z. B. cis''' auf der g-Saite, indem a gegriffen und dann die Stelle von cis' (1/5) leicht berührt wird. Ausführlicheres darüber gibt jede Instrumentationslehre. Das Flageolett spricht auf dicken Saiten (Kontrabass, Cello) leichter an als auf dünnen, aber auf übersponnenen schlechter als auf einfachen.
In der Notierung verlangt man das Flageolett der leeren Saiten einfach durch o über der Note, welche klingen soll (a), das mittels Hilfsgriffs auszuführende Flageolett dagegen durch Notierung des Griffs der zu berührenden Stelle und des erklingenden Tones (wie bei b):
Letztere Notierungsweise kann natürlich auch für das Flageolett leerer Saiten angewendet werden (c, d). Vgl. Mondonville (1735) und Dom. Ferrari.
4) Das seltener angewandte Flageolett der Harfe beschränkt sich auf die Hervorbringung der Oktave durch Berührung der Mitte der Saite; es war unter dem Namen σύριγγες [surigges, altgriechisch] bereits den Kitharaspielern des Altertums geläufig. Vgl. Henryk Heller, Lehre der Flageolett-Töne (Berlin 1927). [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 514f]