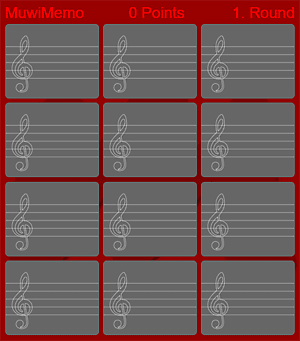Ambrosianischer Gesang (1865)
Ambrosianischer Gesang. Die älteste Art christlich kirchlichen Gesanges, über die wir Nachrichten haben, so benannt nach Ambrosius, Bischof zu Mailand, der ihn im Jahre 380 eingeführt haben soll.
Die herrschenden Ansichten von seiner eigentlichen Beschaffenheit gründen sich mehr nur auf Vermutungen als auf sichere Kenntnisse. Fast mit Gewissheit anzunehmen ist, dass er ein noch einfacherer Gesang gewesen als der Gregorianische, und es scheint mindestens zweifelhaft, ob eine wirkliche Melodie im eigentlichen Sinne ihm zugeschrieben werden darf. Man kann eher vermuten, dass der Sprechton darin vorgeherrscht, die Stimme den Anfangston im wesentlichen festgehalten und nur am Ende des Verses eine melodische Biegung oder auch wohl mitunter eine Art Neuma gemacht habe - eine Art rezitierenden Vortrags, welche in unseren Kollekten und Responsorien bis auf den heutigen Tag sich erhalten hat. Gregor soll die Ambrosianische Vortragsweise auch nur für diese beiden Gattungen von Ritualgesängen beibehalten haben, indem sie ihm für Psalmen und Hymnen, wofür sie vor ihm ebenfalls gedient hatte, zu einfach erschien.
Bestimmte und abgeschlossene Tonreihen aber müssen dem Ambrosianischen Gesänge nichtsdestoweniger als Grundlage gedient haben, wenigstens soll Ambrosius aus den griechischen Oktavgattungen vier für seinen Gesang ausgewählt haben, nämlich die Phrygische D-d, Dorische E-e, Hypolydische F-f, und Hypophrygische (ionische) G-g, von den alten Schriftstellern christlicher Zeit Protus, Deuterus, Tritus und Tetrardus tonus (erster, zweiter, dritter und vierter Ton) und auch mit den griechischen Provinznamen, aber in veränderter Ordnung (Dorisch D-d, Phrygisch E-e, Lydisch F-f, und Mixolydisch G-g, siehe Tonart) benannt. Doch wissen wir nichts Gewisses von der Anwendung dieser Tonarten im Ambrosianischen Gesang.
Ob Ambrosius seine Gesänge zu notieren verstanden hat, ist ebenfalls zweifelhaft (von seinem Antiphonale sollen noch im späteren Mittelalter Abschritten mit Noten vorhanden gewesen sein, aber man weiß von deren Beschaffenheit ebenso wenig etwas Sicheres). Doch lässt sich annehmen, dass er der griechischen Notation sich bedient habe, die ihm doch bekannt gewesen sein muss, da die ganze italienische Musik des Mittelalters von der griechischen Theorie ausging. Jedenfalls aber mag die Echtheit des Gesanges bald sich verloren und durch die unvollkommene Überlieferung mannigfache Entstellung sich eingeschlichen haben, weshalb Gregor späterhin sich veranlasst sah, eine Reinigung und Erneuerung des Kirchengesanges vorzunehmen, wobei dann allerdings das, was vom Ambrosianischen Gesang bis dahin noch etwa echt und unverfälscht sich erhalten haben mochte, in der neuen Gesangsart aufgegangen sein wird.
Vom Gregorianischen Gesang unterschied sich der Ambrosianische, neben der unzweifelhaft noch bei weitem einfacheren Melodie, besonders durch seine metrische Einrichtung. Der Gregorianische cantus choralis war planus, bestand nur aus Noten von gleicher Zeitdauer, der Ambrosianische Gesang hingegen hatte, ähnlich der hebräischen Psalmodie, geregelte metrische Länge und Kürze, dem Sprachakzent entsprechend, eine Eigenschaft, die ebenfalls die Ansicht unterstützt, dass er mehr eine erhöhte Deklamation gewesen sei und als solche mehr das Sprachmetrum als die melodische Biegung berücksichtigt habe. [Dommer Musikalisches Lexicon 1865, 46f]