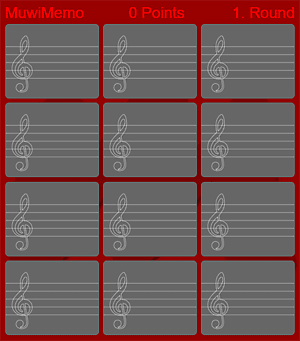Musikkritik (1929)
Musikkritik. Die Geschichte der Musikkritik beginnt bei den Musiktheoretikern, deren Polemiken bereits eine Technik der Musikkritik ausbilden, aber auch in Vorreden, Widmungen von Musikdrucken des 16. Jahrhunderts. Als Repräsentant dieser frühen Regungen mag Glarean (Dodekachordon) gelten. In englischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts zeigt sich neben der Konzertanzeige auch schon der Ansatz zur Aufführungskritik. Den Übergang zur ästhetischen Werkkritik macht Mattheson (Critica Musica, 1722), und im Lauf des 18. Jahrhunderts entwickelt sich dann in den französischen und deutschen periodischen Schriften (M. Grimm bei den Enzyklopädisten; Scheibes Critischer Musicus; Joh. Adam Hiller; Schubart) eine spezifische Musikkritik; vor allem die Pariser Kämpfe um Gluck haben die Publizität der Musikkritik mächtig gefördert, ähnlich wie vordem das Auftreten Händels in England. Die Werkkritik geht immer mehr über auch zur Kritik der Leistung; zum Mitarbeiterkreis von Fr. Rochlitz an der Allgemeinen Musikalischen Zeitung gehört als erster idealer Vertreter der Musikkritik E. T. A. Hoffmann, der die Reihe der Schöpfer-Kritiker des 19. Jahrhunderts: Schumann, Berlioz und Wagner eröffnet. Berlioz ist von den dreien bereits der Berufskritiker, der Exponent des großstädtischen Musikbetriebs. Als Typus des journalistischen Berufskritikers gilt der Kritiker der Wiener Neuen Freien Presse, Eduard Hanslick.
Diese journalistische Kritik meint man im Allgemeinen, wenn man von Musikkritik spricht: Ihre Aufgabe besteht darin, zwischen dem Kunstwerk, der künstlerischen Darbietung und dem Publikum zu vermitteln; der Kritiker steht im Dienst der Öffentlichkeit. Über die moralischen Bedingungen der Musikkritik ist kaum zu reden: Sie bestehen in Mut, Wahrheitsliebe, Besonnenheit und der Erkenntnis der Subjektivität alles Urteilens bei möglichstem Streben nach "Objektivität". Zu den ästhetischen Bedingnissen gehört die Fähigkeit intensiven, aktiven "Hörens" oder Nacherlebens, die Fähigkeit, dies Erlebnis in Worte zu fassen, die umfassende musikalische und geschichtliche Bildung, um über die "Impression" hinaus zur Wertung zu gelangen.
Vgl. über das Geschichtliche: Fritz Stege, Die deutsche Musikkritik des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluß der Affektenlehre (ZfMW. X, 1; 1927); zum Grundsätzlichen u. a.: Herm. Springer, Normen und Fehlerquellen der Musikkritik (Mitteilungen des Vereins deutscher Musikkritiker - siehe Vereine, auch Melos IV, 2); M. Friedland, Kritik als kulturphilosophisches Problem (Berlin 1925); auch Calvocoressi, The Principles and Methods of Musical Criticism (London 1923). [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 1237f]