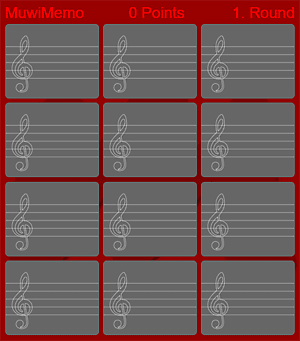Kammerton (1882)
Kammerton, so viel wie Normaltonhöhe. Da man früher kein Mittel kannte, die Schwingungen zu zählen, so existierte eine ein für allemal festgesetzte absolute Tonhöhe nicht, sondern dieselbe veränderte sich im Lauf der Zeiten vielfach nach der Höhe und nach der Tiefe. Im 16.-17. Jahrhundert scheint dieselbe sehr hoch gewesen zu sein, was aus der Stimmung alter Orgeln hervorgeht, welche ungefähr einen ganzen Ton höher stehen als unser Kammerton. Doch ging die Stimmung allmählich herunter, besonders als sich eine selbstständige Instrumentalmusik, die Kammermusik, außerhalb der Kirche entwickelte, welche daher bald ihre eigene Normaltonhöhe bekam, die von der der Orgeln, nach welcher der Chor sang (Chorton), als Kammerton unterschieden wurde. Noch höher als der Chorton war der Kornettton (eine kleine Terz über dem Kammerton), vermutlich die Stimmung der Stadtpfeifer.
Chorton und Kammerton haben sich nebeneinander längere Zeit gehalten und sind beide ungefähr parallel herauf- und heruntergegangen. Auch nach Antiquierung des Chortons schwankte der Kammerton noch lange, bis die Aufstellung des Diapason normal durch die Pariser Akademie 1858 (hoffentlich für immer) die Normaltonhöhe des eingestrichenen a auf 875 einfache oder 437,5 Doppelschwingungen in der Sekunde feststellte. Weiteres siehe unter A. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 435]