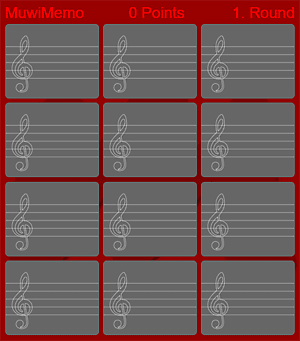Heterophonie (1929)
Heterophonie (ἑτεϱοφωνία [heterophonia]) nennt Plato (leges VII. 812 D. [7. Buch der Νόμοι]) zusammenfassend die den alten Griechen allein geläufigen Arten der Abweichung vom strengen Unisono, die in älterer Zeit (Archilochos im 7. Jahrhundert v. Chr.) mehr in eingestreuten Ziertönen des die Gesangsmelodie mitspielenden Instruments ([…]), später (im 4. Jahrhundert v. Chr.) dagegen in bunter Ausschmückung des Gesangs selbst durch Koloraturen bestand. Namen und Erklärungen der einzelnen Verzierungen hat uns der sogenannte Bellermannsche Anonymus usw. (4. Jahrhundert n. Chr.) überliefert (instrumental: Proskrusis, Proskrusmos, Ekkrusmos, Kompismos; vokal: Proslepsis, Eklepsis, Eklemmatismos, Melismos). Vgl. Riemann, Handbuch der MG. I, 1, sowie desselben, Die byzantinische Notenschrift im 10.-15. Jahrhundert, 1909, woselbst ausgeführt wird, dass die Hypotaxis der byzantinischen Notenschrift in der antiken Heterophonie wurzelt.
Bei der großen Ähnlichkeit der nachweisbaren Entwicklung der einstimmigen Musik bei den Ostasiaten und den Griechen können die Beispiele verzierter Begleitung einer einfachen Gesangsmelodie, welche A. Dechevrens in der Studie Sur le système musical chinois (Sammelb. der IMG. II, 4) gibt, von der Heterophonie der Griechen einen Begriff geben. Vgl. auch Guido Adlers Aufsatz Über Heterophonie im Peters-Jahrbuch 1908. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 751]